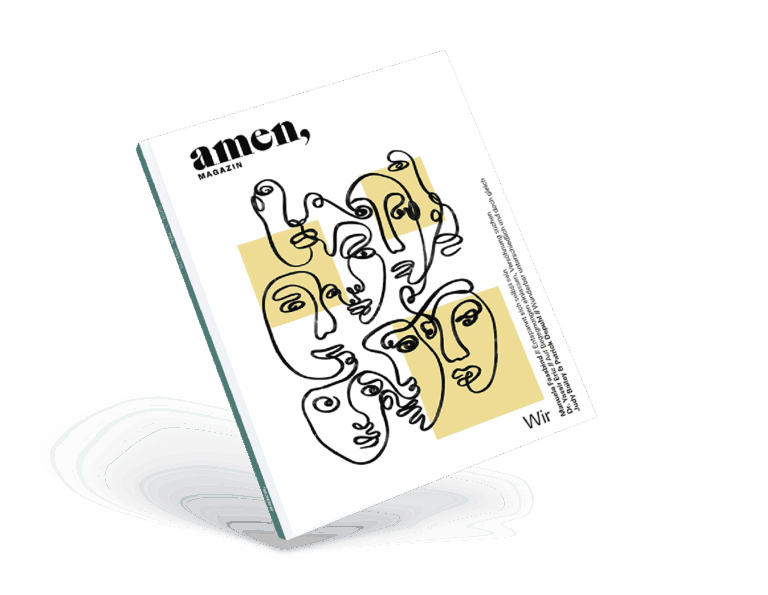Begegnungen als Brücken
| von |
Christoph Rhyner |
Dr. Yassir Erics Lebensgeschichte liest sich wie ein Roman. Aufgewachsen im Sudan in einem einflussreichen, streng muslimischen Clan, kennt der heutige anglikanische Bischof die Auswirkungen von Hass und weiss, wie ein friedliches Miteinander möglich wird.

DR. YASSIR ERIC IM INTERVIEW
Wie hast du Unmenschlichkeit in deiner Kindheit erlebt?
Als Kind habe ich den Bürgerkrieg im Sudan miterlebt, wo Menschen gejubelt haben, als andere massakriert wurden. Das war für mich die erste Begegnung mit purer Unmenschlichkeit. Aber ich habe sie auch selbst gelebt. Unmenschlichkeit war Teil meiner Erziehung und Prägung. Sie wurde mir als Normalität vermittelt. Im Alter von acht Jahren brachte mich mein Vater in die Koranschule, wo Gewalt als Erziehungsmittel eingesetzt wurde. Wir lernten dort zwei Jahre lang den Koran auswendig, ohne zu reflektieren. Mein Ziel war, ein Hāfiz zu werden, eine Person, die den gesamten Koran auswendig rezitieren kann. Ich lernte, das Wort Toleranz nie zu verwenden, und wurde darin geschult, Menschen zu hassen, die nicht so dachten wie wir, anders aussahen oder einen anderen Glauben hatten.
Du erzählst in deinem Buch «Hass gelernt – Liebe erfahren» von einem christlichen Mitschüler, der deinen Hass zu spüren bekam.
Ja, die Geschichte von Zacharia ist mir immer präsent. Ich habe ihn als meinen Feind gesehen, weil er anders glaubte und anders aussah. Meine Freunde und ich wollten ihn umbringen und haben ihn brutal verprügelt. Ich höre noch heute seine Schreie. Auch gegen Juden waren wir voller Hass, ohne sie wirklich zu kennen. Wir haben gebetet, dass Gott die Juden auslöscht. Den Holocaust haben wir verherrlicht. Für mich war damals klar: So ein Handeln war ein Dienst für Allah und den Islam. Ich glaubte, etwas Gutes zu tun, indem ich die «Ungläubigen» bekämpfte.
Ich schämte mich zutiefst und dachte, er würde sich an mir rächen wollen. Aber er war mir gegenüber menschlich, obwohl ich so unmenschlich zu ihm gewesen war.
Jahre später trafst du Zacharia in Kairo wieder. Was löste diese Begegnung in dir aus?
Ich schämte mich zutiefst und dachte, er würde sich an mir rächen wollen. Aber er war mir gegenüber menschlich, obwohl ich so unmenschlich zu ihm gewesen war. Er sagte mir, er habe jeden Tag für mich gebetet. Ich erkannte, dass es nicht schwierig ist, Hass mit Hass zu begegnen. Aber um Hass mit Liebe begegnen zu können, brauchen wir Jesus Christus. In Zacharia habe ich den Menschen Jesus gesehen. Das war eine Begegnung, die meine innerste Überzeugung zerbrach. Ich verstand, dass Jesus nicht der Hassprediger war, als den ich ihn sehen wollte, sondern die Liebe selbst.
Wie kam es zu deiner Hinwendung zu Jesus Christus?
Die erste Saat wurde gesät, als der Sohn meines Onkels todkrank im Krankenhaus lag. Ich war gerade bei ihm, als zwei koptische Christen an sein Bett kamen. Aus Höflichkeit erlaubte ich ihnen, für den Jungen zu beten. Das Kind wurde gesund, und ich begann an dem, was ich über Christen gelernt hatte, zu zweifeln. Ich kam mit den Männern ins Gespräch. Nach stundenlangem Austausch sprach ich ein Gebet: «Jesus, wenn du lebendig bist, will ich dich kennenlernen.» Dieses Gebet hat mein Leben verändert.
Wie hat sich dein Menschenbild seither verändert?
Gott hat mich gefunden durch die Menschlichkeit von Christen. Mein Menschenbild ist heute eines der Hoffnung. Ich glaube, dass jeder Mensch von Gott mit einer unveräusserlichen Würde ausgestattet wird, unabhängig von Herkunft oder Glauben. Wenn mein Gottesbild verzerrt ist, wird auch mein Menschenbild verzerrt sein: Im Islam wurde mir beigebracht, dass wir würdelose Knechte sind, die sich Allah unterwerfen müssen. Im Christentum habe ich gelernt, dass wir Kinder Gottes sind, die eine Beziehung zu ihm haben können.
Du bist heute Bischof. Was möchtest du in deiner Rolle bewegen?
Meine Aufgabe als Bischof von EK-KIOS, die als weltweite kirchliche Bewegung Christen mit muslimischem Hintergrund unterstützt, sehe ich darin, Brücken zwischen Kulturen und Religionen zu bauen. Die Bewegung, die ich ins Leben gerufen habe, ist heute ein Netzwerk, das ehemalige Muslime (sogenannte «Muslim Background Believers») betreut, die sich wegen ihres Übertritts zum Christentum oft Verfolgung ausgesetzt sehen. Mir ist es besonders wichtig, dass wir wieder lernen, menschlich miteinander umzugehen und einen längst überfälligen, kritischen Dialog der Kulturen und Religionen führen. Konflikte müssen offen benannt und gelöst werden, nur so wird ein friedliches Miteinander möglich.
Ich bin zuversichtlich, dass wir wieder menschlicher werden, wenn wir uns auf die Liebe besinnen, die Jesus uns vorgelebt hat.
Du betonst die Verbindung zwischen Judentum und Christentum. Warum ist das in deinen Augen wichtig?
Das Christentum ist ohne das Judentum nicht zu verstehen. Die Heilsgeschichte Gottes läuft durch beide hindurch. Mich stört die Unterscheidung zwischen Altem und Neuem Testament, weil es eine einzige Geschichte ist. Im Islam benutzen wir Begriffe wie «Jesus» oder «Maria», meinen aber völlig andere Dinge. Wenn wir die Wurzeln nicht verstehen, können wir das Endprodukt nicht begreifen. Das Asylprinzip, also dass man Fremde aufnimmt, ist ein zutiefst jüdisch-christliches Prinzip, das uns daran erinnert, dass auch wir Fremde sind, die von Gott auf- und angenommen wurden.
Die Juden waren Sklaven in Ägypten. Im selben Land suchte Jesus als Kleinkind mit seinen Eltern Schutz. Als Gemeinde Jesu sind wir ebenfalls Fremde in dieser Welt.
Wie können wir in einer Welt, die von Polarisierung und Abwertung Andersgläubiger und -denkender geprägt ist, das Menschliche in jedem Menschen sehen?
Das gelingt nur in der direkten Begegnung. Wie ich in meinem Buch schreibe: «Wo keine Begegnung stattfindet, bleibt man fremd.» Wir müssen über unseren Schatten springen und uns auf den anderen zubewegen. Ich habe gelernt, zwischen dem Islam als Dogma und den Muslimen als Menschen zu unterscheiden. Schädliche Glaubensüberzeugungen möchte ich generell hinterfragen, nicht jedoch den Menschen, der diese Überzeugung hat. Das ist schwierig, aber meiner Meinung nach der wahrhaft christliche Umgang miteinander. Fremde sind oft nur Freunde, die wir noch nicht kennengelernt haben.
Das Weltgeschehen scheint von einer sich zuspitzenden Rhetorik geprägt zu sein. Wie nimmst du das wahr?
Ja, das bereitet mir Sorge. Ich sehe, wie der Ton in Politik und Gesellschaft rauer wird. Aber ich bin auch dankbar, in einem Land zu leben, in dem die Würde des Menschen unantastbar ist. Das ist ein hohes Gut und nicht selbstverständlich. In meinem Herkunftsland Sudan ist das nicht der Fall. Was mich betrübt, ist, dass die Menschen dieses Gut zu bewahren versuchen, ohne zu sehen, woher es kommt. Ich wünsche mir, dass Europa wieder zu seinen Wurzeln zurückfindet und erkennt, dass Toleranz und Freiheit nicht einfach so entstanden sind. Sie stammen aus der jüdisch-christlichen Prägung: Gott hat uns so geschaffen, dass wir auch Nein sagen können – das ist der Ursprung von Toleranz und Freiheit. Als Aussenstehender sehe ich vielleicht deutlicher, dass die Kultur und Geschichte Europas mehr zu bieten haben als die Kreuzzüge und den Kolonialismus. Aber wir sind arrogant geworden und haben Gott durch Dinge wie Professionalität und Fortschritt ersetzt. Dabei verlieren wir das Menschliche. Das Kreuz auf der Schweizer Flagge ist nicht nur ein Plus, sondern zeugt von dieser Kultur.
Hast du Hoffnung, dass wir (wieder) menschlicher werden?
Ich bin zuversichtlich, dass wir wieder menschlicher werden, wenn wir uns auf die Liebe besinnen, die Jesus uns vorgelebt hat. Was mir hilft, nicht dem Fatalismus zu verfallen und an das Gute im Menschen zu glauben, ist die Überzeugung, dass wir von Gott so geschaffen wurden, dass wir uns verändern können. Als Gesellschaft, als Einzelne und als weltweite Kirche sollten wir uns wieder an diesen Ursprung erinnern. Wir müssen uns auf die direkten Begegnungen einlassen und Versöhnung suchen, wo Trennung herrscht. Das ist eine Frage des Mutes und der Liebe. Meine Hoffnung ist konkret in Jesus Christus begründet, denn ich weiss, wohin ich gehe, sollte ich heute sterben. Er gibt mir die Gewissheit auf ewiges Leben und das lässt mich zuversichtlich in die Zukunft blicken.
Dr. Yassir Eric setzt sich für interreligiösen Dialog ein und versteht sich als Brückenbauer zwischen Islam und Christentum. Der einstige radikale Islamist musste nach seiner Hinwendung zu Jesus Christus seine Heimat verlassen und wurde von seiner Familie verstossen. Seit 1999 lebt er in Deutschland. Er leitet das Europäische Institut für Migration, Integration und Islamthemen an der AWM Korntal, ist verheiratet und Vater von drei Kindern.
 Bild
Bild