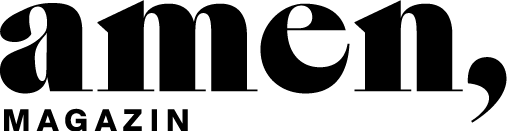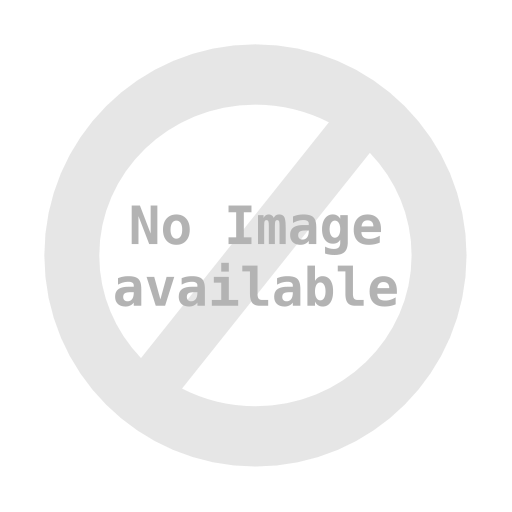Den ganzen Menschen feiern
Gross geworden in Barbados und in Deutschland. Studiert in London und Chicago. Gesungen in über 30 Ländern, gesprochen wird Deutsch und Englisch. Zu Hause sind Judy Bailey und Patrick Depuhl am Niederrhein, in einem Dorf namens Alpen. Ihre Songs und Texte sind erzähltes Leben – sie erzählen vom Dorf und von der Welt, von Wurzeln und der Weite.
»
Die meisten Dinge, die Gott schuf, sind erstaunlich bunt! Vielseitig, vielschichtig, vielfarbig. Oder in anderen Worten: Wir können viel voneinander lernen
«Das leben ist nicht schwarz-weiss» – der Titel des Projektes von Judy und Patrick könnte genauso gut der Claim ihres ganzen Lebens sein. Ich will wissen, wie es denn stattdessen ist, ihr Leben. «Auf jeden Fall sehr voll, sehr bunt, sehr vielfältig, teilweise herausfordernd. Aber voller Güte, Dankbarkeit, Hoffnung und Zuversicht.» Judys und Patricks Alltag ist geprägt von vielen Begegnungen mit sehr unterschiedlichen Menschen. Als interkulturelles Paar wissen sie eines sehr gut: «Der Mensch tendiert zur eigenen, kleinen Welt. Über andere Menschen lässt sich diese kleine Welt wieder weiter, grösser machen. Darin steckt ein enormer Reichtum.»
Ich lebe, weil ich mich bewege. Ich werde. Ich bleibe gespannt – auf mich. Und darum auch und erst recht – auf dich.
Wir treffen uns zu dritt. Online. Wie man das eben so macht, wenn einen geografisch über 600 Kilometer trennen. Ich weiss, dass ihre Tage eng getaktet sind. Umso mehr berührt es mich, dass die beiden mir am Bildschirm in einer fröhlichen Entspanntheit gegenübersitzen, als ob sie alle Zeit der Welt für unser Gespräch hätten. Schnell merke ich: Die beiden sind Menschen-Menschen.
Ich bitte Judy und Patrick, sich gegenseitig zu beschreiben. Judy legt los. Und zwar in einer Weise, als ob sie nicht schon bald drei Jahrzehnte verheiratet wären, sondern sich eben erst verliebt hätten. Patrick sei selbstbewusst, witzig, treu, unterstützend, talentiert, könne gut kommunizieren und gehe überall auf der Welt auf Leute zu, als gäbe es keine sprachlichen oder kulturellen Hürden zu nehmen. Patrick legt nach. Judy sei ein sehr offener Mensch, habe viel Energie, höre Menschen zu, komme ihnen nah und lasse für andere alles stehen und liegen.
Zur Frage, wie sie beschreiben würden, was sie tun: «Weil man, gerade in Deutschland (und in der Schweiz genauso [Anm. d. Autorin]), einen Beruf braucht, um sich zu erklären, ist das unser Beruf: Kunst. Musik. Schreiben. Sprechen.»
Über sich selbst sagen sie auch, sie seien Pilgernde. Sie wollen Lernende, Erlebende und Sich-Verändernde bleiben, weil Leben erstarrt und abstirbt, wenn es sich nicht bewegt. Wie das gelingt? «Auf jeden Fall da, wo man sich mit Menschen auseinandersetzt, die nicht so sind, wie man selbst ist.» Das gelingt, wenn man nicht nur spricht, sondern auch zuhört. Und indem man mit ein bisschen Demut durch die Welt geht. Immer im Bewusstsein, dass es auch andere Perspektiven als die eigene gibt. «Das Ganze ist immer mehr als nur die eigene Erfahrung.»
Judy und Patrick wandern nicht ziellos umher. Pilgern hat ein Ziel. Ihres ist die Ewigkeit. Die grosse Perspektive helfe, Dinge im Hier und Jetzt zu ordnen und Wichtigkeiten richtig zu sehen. In diesem Sinne war auch das Gespräch mit dem syrischen Kurden, der gestern in ihrem Garten sass und mit dem sie über seine Familie sprachen, wichtig. Eben wichtiger als die Dinge, die dringend erledigt werden mussten.
Über andere Menschen lässt sich diese kleine Welt wieder weiter, grösser machen.
Alles, was das Herz und die Hüften bewegt.
Mit der Musik waren die beiden in den letzten Jahrzehnten rund um den Globus unterwegs. «Das Grossartige an Musik ist die Chance, an viele Orte zu reisen. In die Welt und in die Seele.» Von der kleinen Konzertlesung in Deutschland bis zu einem Auftritt in Rio de Janeiro vor Papst Franziskus und drei Millionen Jugendlichen haben sie schon alles gesehen, was das Leben zweier Kunstschaffender so hergibt. Bis zur Pandemie 2020 verging über zehn Jahre lang kein einziger Monat, ohne dass sie irgendwo auftraten. Über eine so lange Strecke von der Kunst zu leben, bedeutet vor allem eines: sehr viel Arbeit. «Kreativität ist zu 90 Prozent Schweiss, nicht Inspiration.» Ideen haben viele. Nur wenige probieren aus, setzen um und bleiben danach dran. Judy und Patrick gehören definitiv zu den Ausprobierern und Dranbleiberinnen dieser Welt. Sie sagen selten «Geht nicht.» oder «Wird kompliziert.», sie sagen: «Wir machen das jetzt einfach und hoffen, dass es funktioniert.»
Judy zeichnet unter anderem ihr «hörendes Herz» aus. Und so entstehen ihre Lieder nicht aus dem luftleeren Raum, sondern aus den Dingen, die sie hört, wenn sie in sich selbst hineinhört, andern und auch Gott zuhört. «Ich möchte das, was ich habe, anbieten und nicht für mich behalten. Das bleibt meine Motivation.» Ob das bedeutet, über Jahrzehnte hinweg neue Lieder zu schreiben und sie mit anderen zu teilen oder im eigenen Dorf einen Raum zu schaffen, wo sich Leute begegnen, die sich sonst nie begegnen würden, ist für die beiden einerlei. In allem, was sie mir erzählen, spüre ich ihren Antrieb, aus der persönlichen Beziehung zu Gott heraus Grosszügigkeit mit Menschen zu leben. So entsteht etwas Echtes zwischen Menschen.
Keiner soll ein Fremder sein.
Judy und Patrick leben mit ihren Söhnen auf dem Dorf. Ein grosser Kontrast zu den Orten, die sie weltweit besuchen. Aber auch ein guter Gegenpol zu dem vielen Unterwegssein. Die Welt ist auch in ihrem Dorf zu finden. Genauer im Zentrum für Geflüchtete. «Bei uns wurde aus einem viel zu lange währenden ‹Man müsste mal› an einem Nachmittag ein schlichtes ‹Wir gehen jetzt einfach!›.» Aus diesem Losgehen entstanden eine Arbeit mit Geflüchteten, ein Verein und unzählige Events und Initiativen. Nicht leicht, den Überblick zu behalten, wenn die beiden davon berichten, so vieles hat über die Jahre stattgefunden. Da sind erstmal die Sommer- und Begegnungsfeste, wo so unterschiedliche Geschichten zusammenkommen, weil so unterschiedliche Menschen auf ein und derselben Festbank sitzen.
Von der Kurdin bis zum Bundestagsabgeordneten. Dann hatten die beiden auch schon mal die Idee der «Küchentischgespräche». Drei Deutsche an einem Tisch, die verschiedener nicht sein könnten. Denn: Deutschsein sieht man einem nicht an. Es gibt solche, solche und solche. Und immer wieder verbinden Judy und Patrick den Gemeinschaftsgedanken mit Musik und laden Geflüchtete aus dem Dorf zum Singen ein. Was als Workshop in der Schule begann, wurde zum Projekt «HOME.Alpenmusik», zu mehreren Konzerten, Open Airs und Musikproduktionen in Zusammenarbeit mit fünf Musikvereinen aus dem Dorf. «Das war musikalisch und menschlich irgendwo zwischen Abenteuer und Wunder!» Eine Zeile aus einem Lied, das bei dieser Initiative entstand:
Schau mich an und sieh den Mensch in mir. Wunder und Welten treffen sich hier.
Das sangen sich die Menschen im beschaulichen Dorf Alpen zu. Und meinten es genau so. Dieses «Sehen und Gesehenwerden» macht einen grossen Unterschied. «Wir wollen den ganzen Menschen sehen. Nicht die Schubladen, die mit ‹geflüchtet› oder ‹muslimisch› oder ‹deutsch› beschriftet sind. Wenn du die Leute wirklich kennst, sprichst du nicht so über sie. Dann sprichst du einfach von ‹Alischer› oder von ‹Malalai›.» Ihr Engagement beschreiben Judy und Patrick als «Protest gegen Grossmaulparolen im Besonderen und die Ungerechtigkeit der Welt im Grossen und Ganzen.» Wir unterschlagen einen Schatz, wenn wir die soziokulturelle Erfahrung anderer nicht integrieren. Dafür muss man aber, egal ob in kirchlichen, gesellschaftlichen oder privaten Kontexten, Leute aus verschiedenen Hintergründen mit an den Tisch holen. Eine Gruppe von weissen Männern im mittleren Alter ist nun mal nicht vielseitig.
Auch im Privaten läuft das bei Judy und Patrick nicht anders. Sie verstecken beispielsweise an Ostern 160 Eier im eigenen Garten und laden alle ein, die kommen wollen. Auch die, die Ostern gar nicht kennen. Und so wurde dieser Feiertag tatsächlich ein Fest des Lebens. «Es ist ganz einfach. Wir sind so beschenkt von Gott. Wir haben alles. Es ist das Mindeste, was wir machen können.» Die Familie Bailey-Depuhl findet immer einen Grund zu feiern. Egal ob Feiertag, abgeschlossene Bachelorarbeit, ein anstehendes Jahr im Ausland oder 55 Lebensjahre. Als ich mit Judy und Patrick spreche, steht die nächste «Fami-ly-Sommer-Party» vier Tage bevor. «Es werden wohl weit über hundert Menschen da sein. Die Nachbarin genauso wie Geflüchtete, der Pfarrer und der Bürgermeister.» Übrigens: Man müsse nicht immer gross denken. Es gehe auch ganz klein. «Aber irgendwie mal machen.»
Wir reden und denken, hoffen und lieben, wir zweifeln, verzweifeln manchmal und immer wieder überleben wir.
Judy und Patrick erzählen in ihrem Projekt «Das Leben ist nicht schwarz-weiss» nicht nur die schönen, sondern auch die schweren Geschichten. Und die Geschichten hinter den Geschichten. Sie lassen die Lasten, aber auch die Hoffnung nicht aus. «Man sollte beides erzählen.» Ihr Normal ist durchmischt. Wie bei allen von uns. Judy und Patrick sind Farbenund Hoffnungssammler, aber auch Verletzte und Stolpernde. Nichts bleibt bei den beiden an der Oberfläche. Auch nicht die Rede von der Verletzlichkeit. Sie legen den Finger auf die Stellen, die weh tun. Auf schattiges Familienerbe, ungelöste Geschichten, eine schwierige Vaterbeziehung, den jahrelangen Kampf mit Bulimie, Alltagsrassismus in Deutschland, strukturelle Ungerechtigkeit, Auswirkungen des Kolonialismus auf Barbados. Sie schreiben und singen von sich und über sich, aber auch über ihren Blick auf die Welt. Persönlich, biografisch, politisch und gesellschaftskritisch.
Wir wachsen auf dem Humus des Vergangenen.
Unser Erbe, unsere kulturelle Prägung, trägt entscheidend dazu bei, wer wir sind. «Knowledge is Power», sagt Judy dazu. Das ist der Grund, warum die beiden tief graben, eine innere Reise zu ihren Wurzeln gemacht haben. Das Bild des Baumes ist ihnen dabei wichtig. «Wenn wir gute Früchte sehen wollen, uns um die Pflanze, die unser Leben ist, kümmern wollen, müssen wir uns auch für die Wurzeln interessieren.» Auch wenn es schwer ist. Auch wenn wir dabei auf Dinge stossen, die kein Mensch sich freiwillig in den Rucksack packen würde. Nur so entsteht ein neues Bewusstsein für die eigene Erfahrung.
Dass ich überhaupt hier bin, erfahre ich als Segen, wenn ich an meine Vorfahren denke, die viel überleben mussten.
Die Ware waren wir.
«Dass ich überhaupt hier bin, erfahre ich als Segen, wenn ich an meine Vorfahren denke, die viel überleben mussten.» Wenn Judy über Generationen zurückblickt, ist da eine Geschichte von ausgerissenen Wurzeln. Westafrika, Sklaverei, die ganzen Abgründe von Unmenschlichkeit, Unterdrückung und Grausamkeit. «Unsere DNA hat Afrika nie vergessen.» Judy hätte so viel Grund, wütend zu sein. Heute als selbstbestimmte Frau zu leben, mit einem weissen Mann verheiratet sein zu wollen – pure Güte und Segen in Judys Retrospektive. Der Fluch liegt darin, dass die Geschichte bis ins Heute reicht. «Wenn ich rausgehe, könnte ich beleidigt und bespuckt werden, unsere Kinder könnten in Gefahr geraten, sie erleben immer wieder Diskriminierung. Das ist unsere Realität.»
Sometimes it can change everything knowing where you come from.
Judys grosses Herz für die Geflüchteten in ihrem Dorf kommt nicht aus dem Nichts. Es versteht, weil es selber weiss. Gefragt nach ihrem Umgang mit dem Schmerzhaften, zu dem ihre Blutslinie führt, sagt sie: «Für mich ist es, wie es ist. Es ist ein Teil von dem, was ich trage.» Daran, wie Judy das sagt, haftet nichts Passives und auch kein Übertünchen. Sie benennt Unrecht klar, spürt den alten, unmenschlichen Geschichten nach, entscheidet aber selbst, was sie damit machen will. «Ich bin nicht Opfer.» «Gewisse Dinge muss man tragen, aber nicht immer ertragen», ergänzt Patrick.
Rassismus ist ein Schweinehund. Wir sollten ihn endlich ertränken. Das Problem: Das Biest kann schwimmen!
Judy und Patrick leisten mit ihrer Kunst auch viel Aufklärungsarbeit in Sachen Rassismus. Als ich in Deutschland kürzlich einen kleinen Teil ihrer Konzertlesung besuchen durfte, machte ich folgende Beobachtung: Als sie auf die «weissen Privilegien» zu sprechen kamen, stand ein älterer, weisser Herr auf und verliess den Raum. Sehr schlechtes Timing, dachte ich. Vielleicht musste er nur aufs Klo. Vielleicht aber auch nicht. Privilegierte sollten zuhören und nicht ausweichen. Nicht mit Beschwichtigungen und Besserwisserei reagieren, nur weil es unangenehm wird. «Wir sind nicht an allem schuld, sind aber auch nicht so unschuldig, wie wir es gerne hätten.»
Es gibt eine menschliche Rasse, aber eben nur eine!
Judy und Patrick wünschen sich Menschen, die Antirassisten werden. Solche, die versuchen, zu entlernen. Einen Schritt zurück machen und Zuschreibungen, die sie automatisch machen, hinterfragen. Denn: «Wir sind wunderbar unterschiedlich und andererseits einfach gleich.»
Ich bin beschenkt und gesegnet durch meinen Vater. Aber auch zutiefst verletzt. Da ist beides da.
Manchmal übermannt das Dunkle das Licht.
Patricks Wurzeln gehen zurück in ein Nachkriegsdeutschland, in eine Zeit, in der die meisten entschieden, nicht mehr über das zu reden, was war. Patrick ist auf einem Hof aufgewachsen, den seine Eltern zu einem Jugendcamp umgebaut haben. «Erstmal war so aufzuwachsen ein grosser Segen. Gleichzeitig war auch immer so eine Last da. Etwas Verstecktes. Ich konnte es nie benennen.» Viel wurde verschwiegen und blieb ein Geheimnis. «Das Unausgesprochene hat sich anders erzählt. In der cholerischen Art des Vaters. In Wut.» Eine Aussprache oder Versöhnung ist nicht mehr möglich. Patrick entdeckt erst nach dem Tod seines Vaters Familiengeheimnisse, die in ein Lebensborn-Heim der SS zur Zeit des Nationalsozialismus zurückgehen. Grosse Teile der Vergangenheit bleiben ungeklärt. Erst die heutige Enkelgeneration in Deutschland, zu der Patrick gehört, will wissen, wie ein gesunder Umgang mit den Dingen gelernt werden kann, über die alle nur schwiegen.«Ich bin beschenkt und gesegnet durch meinen Vater. Aber auch zutiefst verletzt. Da ist beides da.»
Die Fähigkeit, das Dunkle und Schwierige zu integrieren in ihre Geschichte, beeindruckt mich. Bei Judy und Patrick steht der Schmerz mit der Lebensfreude. Die Ungerechtigkeit mit der Grosszügigkeit. Der Schatten mit dem Licht.
Für uns ist es eine Gnade und ein Wunder.
Ein grosses Dennoch Gottes. Die Hoffnung. Die Liebe.
Das Leben. – Sie lassen sich nicht unterkriegen.
Patrick Depuhl ist Autor, Kommunikationswissenschaftler und eine Stimme, die bewegt. Mit Judy ist er unterwegs mit Konzerten und musikalischen Projekten. Zurzeit auch mit «Das Leben ist nicht schwarzweiss» – zutiefst persönliche Geschichten und Songs.
Judy Bailey ist Singer-Songwriterin und studierte Psychologin. Sie spielte ihre Lieder vor Millionären, Präsidentinnen und dem Papst, ebenso vor Obdachlosen, Geflüchteten und Gefangenen.