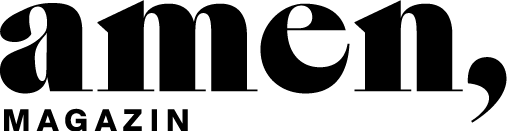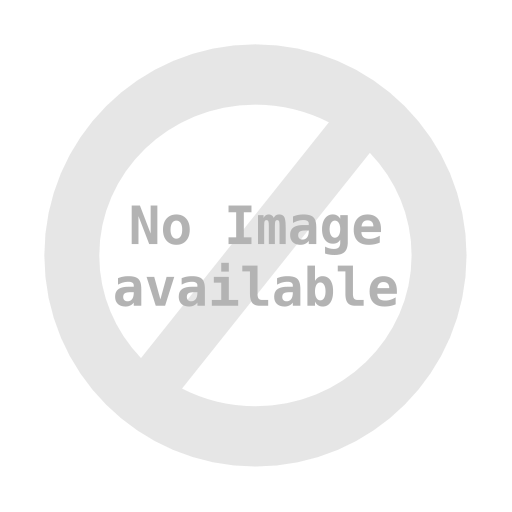Im Dazwischenland
Letzten Sommer habe ich es zum ersten Mal geschafft: Ich habe meinen Dreitagebart während drei Monaten zu einem Vollbart wuchern lassen. Was mich mit meinem Vorhaben zuvor scheitern liess: Entweder war mir der Sommer zu heiss oder die langen Härchen juckten unerträglich.
»
Eines haben viele Übergänge gemeinsam: Sie sind kratzbürstig und unbequem. Ich habe es mir angewöhnt, als Leiter immer wieder aktiv das Unbequeme zu suchen. Mein Naturell bevorzugt eigentlich Harmonie und Schmerzvermeidung. Tatsächlich aber haben die meisten Systeme einen natürlichen Hang zum Gleichgewicht – wie Moleküle in einem System, die sich so lange verteilen, bis sie maximale Entropie erreicht haben. Dann gibt es jedoch keine Bewegung mehr im System, es gilt als tot. An vielen Orten, in Teams und Projekten habe ich immer wieder dasselbe erlebt: Es wird fröhlich über Change gesprochen, aber sobald Veränderung dann an der Haustür klingelt, kriegt man seinen Hintern nicht vom Sofa hoch. Deshalb suche ich bewusst immer wieder Neues und neue Wege. Die Veränderung ist unser Freund, weil sie uns in Bewegung hält. So eine Störung kann ein Projekt sein, eine neue Teamkonstellation, ein neues System, im Falle von Campus für Christus eine Explo-Konferenz, oder auch einfach nur schon eine neue Kaffeemaschine. Der Umzug des Zürcher Hub-Standortes nach über 40 Jahren am selben Ort war eine notwendige Störung unserer eingefahrenen Arbeitsabläufe und Muster. Der Prozess fühlte sich ähnlich an wie das, was das Volk Israel beim Auszug aus Ägypten erlebte. Erstens schien alles länger zu dauern als erwartet. Zweitens sind wir genau wie das Volk euphorisch aufgebrochen, um dann während der langen Wartezeit zu dem Schluss zu kommen, dass es am alten Ort doch gar nicht so schlimm war. Es kam zu Ermüdungserscheinungen und plötzlich wollten wir gar nicht mehr so dringend ausziehen. Rückblickend lässt sich stellvertretend für viele Dazwischenland-Prozesse sagen: Es war gut und die unbequeme Wegstrecke wert. Wir waren gezwungen, uns mit Systemveränderungen, Paradigmenwechseln und neuen Ministryformen auseinanderzusetzen, miteinander unterwegs zu sein, gemeinsam zu «leiden» und zu hoffen. Dieses Dazwischenland wird als wichtiges Abenteuer in den Memoiren von Campus für Christus einen Platz bekommen. Es hat uns als Bewegung in eine neue Phase gebracht.
Ausharren und anpacken
Manche Übergänge in meinem Leben haben sich angedeutet. Als vor einigen Jahren das erste graue Barthaar auftauchte, um eine nächste Lebensphase anzukündigen, zupfte ich kleiner Don Quichotte es irritiert aus. Es sollte sich als Kampf gegen Windmühlen herausstellen. Die einzelnen Haare waren nur Vorboten eines unausweichlichen Übergangs, wie die ersten Regentropfen, die einen Wetterumschwung ankündigen. Entspannt hat sich die Situation vor dem Spiegel erst wieder, als ich realisiert habe, dass das mein neues Ich ist und es gar keinen Grund gibt, mich gegen das Weis(s)er-Werden zu stemmen.
Dazwischenländer haben mit Wartezeiten zu tun. Auf meine aktivistische Natur wirkt das beschwerend. Sehr gerne würde ich Prozesse anschieben, beschleunigen und das Warten im gefühlten Leerlaufmodus vermeiden. Deshalb bin ich auf Flugreisen so minimalistisch wie möglich unterwegs. Wenn ich nur mit Handgepäck reise, erspart mir das Zeit am Gepäckband, das für mich in die Top 5 der unnötigsten Orte gehört, an die ich keine Lebenszeit verschenken möchte. Viele Dazwischenländer sind leider abkürzungsfrei gebaut. Manche Dinge müssen reifen, und das gilt sehr oft für einen selbst. Ich hatte als Teenager den Traum, dass ich irgendwann einmal in Stadien stehen werde. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass diese Vision nicht aus mir herauskam, aber ich hatte auch keinen Plan, wie sich das für einen kleinen Ostschweizer Dorfjungen bewahrheiten sollte. Deshalb verschwieg ich ihn und vergass ihn bisweilen. Rund zwanzig Jahre später sprach ich innerhalb kurzer Zeit zweimal in einem Stadion in der Schweiz und in Deutschland. Ich erinnerte mich daran, wie Gott mir diesen Traum schon früh ins Herz gelegt hatte. Das persönliche Reifen im Land zwischen Traum und Erfüllung war für mich essenziell wichtig. Wartezeiten sind keine Leerlaufzeiten. Manchmal muss sich erst der Nebel im Leben lichten, bis sich neue Wege abzeichnen. Oder es gilt auszuharren und zu warten, bis sich Umstände ändern, bis sich eine Tür öffnet, bis Gott auftaucht. Bis sich die Wolke erhob, hiess das für das Volk Israel in seiner Wüstenzeit (4. Mose 9,17). Das war das Zeichen, dass es weitergehen sollte. Diese Momente dürfen dann nicht verschlafen und die nötigen Prozesse müssen aktiv gestaltet werden.
Manche Dinge müssen reifen, und das gilt sehr oft für einen selbst.
Umarmen und weiterziehen
Neben Wasser und Kälte – ja, ich wurde diesen Winter zum sonntäglichen Schwimmen im Rhein überredet und mag eigentlich weder Kälte noch Wasser – gibt es noch andere Paarungen, die ausserordentlich schlecht zusammenpassen. Gurke und Schokoladencreme zum Beispiel. Oder Kieswege und Sandalen. Letzteres ist eine schon fast traumatische Kindheitserinnerung, weil ich nicht verstehen kann, wieso ich als Am-Bodensee-Aufwachsender auf den kiesbedeckten Wegen, die das Südufer des Sees säumen, zwingend mit Sandalen beschuht unterwegs sein musste. Im Minutentakt verfing sich so ein fieser Kieselstein zwischen Schuhbett und Fusssohle, um dort quälende Irritationen hervorzurufen. Genau so stelle ich mir die Wartezeiten des Volkes Israel vor, als es sich durch die Sand- und Steinabschnitte der Wüste Sinai bewegte. Und genauso können sich auch Lebensübergänge oder Veränderungsprozesse in Beziehungen oder Organisationen anfühlen: unbequem wie ein Fremdkörper unter der Fusssohle, leicht irritierend bis schmerzhaft. Weil im Gegensatz zum Kieselstein diese Entwicklungsschritte aber wichtig sind, gilt es zu lernen, den Schmerz auszuhalten, das Dazwischenland zu umarmen.
Bei allem Aushalten gilt es, das angestrebte Ziel, das «verheissene Land», nicht aus den Augen zu verlieren. In verschiedenen Change-Prozessen, die ich persönlich miterlebt habe, war die anstrengende Zeit im Dazwischenland oft ein Grund, warum Menschen am Ende ihr angestrebtes Ziel aufgaben. Der Kiesel in der Sandale drückte, der Weg erschien zu anstrengend und zu hochpreisig. Lieber griff man zum Pinsel, um den Status quo golden anzustreichen.
Das ist vielleicht am ehesten vergleichbar mit Mose, der sich in der Wüste Midian bequem eingerichtet hatte. So bequem, dass er seine ursprüngliche Lebensberufung aus den Augen verlor und im Dialog mit Gott alle Gründe vorbrachte, um in diesem Dazwischenland bleiben zu können. Ach Herr, schick doch lieber einen anderen! (2. Mose 4,13) war nach vier erfolglosen Ausreden der letzte klägliche Versuch. Mose hatte sich sein Dazwischenland golden angemalt. Er wollte sich auf keinen Fall dem erahnten Schmerz und den Anstrengungen der Reise durch dieses Land hindurch ins neue Land hinein aussetzen. Die Angst vor dem energetischen Aufwand kann den Blick vernebeln für die Tatsache, dass das Neue zwar nicht immer schmerzfrei, aber immer gut für uns ist, wenn Gott mit uns ist (Jakobus 1,17). Für mich bleibt eine Spannung bestehen: Im Hier und Jetzt leben und gleichzeitig nicht vergessen, den Blick hoffnungsvoll immer mal wieder auf den Horizont zu richten.
Das Dreiländer-Lügeneck
Wie eine Fata Morgana über dem Wüstensand können in unseren Wüstensituationen «Halluzinationen» auftreten: Verklärte Zukunftsträume verweben sich mit schöngefärbten Vergangenheitserinnerungen. Wenn man zu wehmütig mit dem linken Auge nostalgisch nach hinten schaut und gleichzeitig mit dem rechten hoffnungsüberhöht eine unrealistische Zukunft anvisiert, bleibt kein Auge übrig, das den Gestaltungsspielraum im Dazwischenland sieht.
Wenn die Wolke sich hebt, erhebe ich mich auch, wenn sie stehen bleibt, dann bleibe ich mit ihr stehen.
Ich habe mich im Leben auch schon an einem Dreiländer-Lügeneck wiedergefunden. Von dort aus sieht man in alle Richtungen unscharf. Rückblickend wird alles romantisiert. Die Kartoffeln waren gross wie Melonen, früher war alles besser und sowieso war Ägypten doch gar nicht so schlecht (4. Mose 11,3). Man redet sich aus Angst vor Veränderung den Status quo schön, und Manna schmeckt doch gar nicht so übel. Zudem schaut man entweder verklärt in eine unrealistische Zukunft oder findet das zukünftige Land – wegen der Riesen und Menschenfresser – gar nicht mehr erstrebenswert (4. Mose 13,32–33). Wieso überhaupt über den Jordan? Wie einige der Stämme will man einfach lieber bleiben, wo man ist (4. Mose 32,5).
Wir glauben der Lüge, woher wir kommen, wo wir sind und wohin es geht. Und verlieren den Blick für das, wohin Gott uns im Leben eigentlich führen möchte. Dabei galt damals wie heute: Keine von all den Zusagen, die der Herr dem Haus Israel gegeben hatte, war ausgeblieben; jede war in Erfüllung gegangen (Josua 21,45).
Der Dazwischenland-Dreiklang
Ich habe gelernt, mich mit Dazwischenländern zu versöhnen, mich mit ihnen anzufreunden, sie zu umarmen und sie gleichzeitig nicht so fest lieb zu gewinnen, dass ich mich nicht mehr bewegen möchte.
Für mich ist Gottvertrauen eine wichtige Lebensdynamik. Ich vertraue Gott, dass er mit mir unterwegs ist, dass er mich leitet und begleitet. Wenn die Wolke sich hebt, erhebe ich mich auch, wenn sie stehen bleibt, dann bleibe ich mit ihr stehen. Mit den Ländern, durch die ich mich hindurch bewege, möchte ich ehrlich umgehen. Ich will meine eigenen Lügen entlarven und mutig Veränderungen anpacken. Dabei hilft mir der folgende Dreiklang: dankbar über die Schulter schauen, aktiv in der Gegenwart leben, hoffnungsvoll vorwärts blicken.
Dazwischenländer sind kein notwendiges Übel, sondern Teil meines Lebensabenteuers. Denn auch das gesamte Leben selbst ist letztlich nichts anderes als ein Dazwischenland. Von Gott her, gemeinsam mit Gott, auf Gott zu. Es lohnt sich, diese Reise immer wieder ganz bewusst zu gestalten – ausharrend, aktiv und wo immer möglich geniessend.